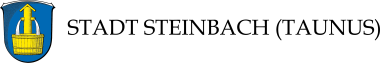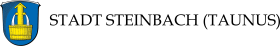Stadtwappen
Wie Steinbach zu seinem Wappen kam
Märchen und Geschichten aus dem Taunus von Georg Volker Dietrich
Schon in alten Zeiten hatte das Dorf Steinbach, das heute zur Stadt geworden ist, einen Brunnen im Wappen. Wenn man fragt, wie dieser Brunnen in das Ortswappen gekommen ist und nachforscht, dann stößt man auf eine uralte Sage, die bisher niemand aufgeschrieben hat und die in keiner Chronik vermerkt oder verbürgt ist. Aber die Sage soll wahr sein, wie mir eine uralte Steinbacherin versichert hat – ebenso wahr, sind alle Märchen, die ja auch einen wahren Kern haben. Und auf diesen kommt es in jedem Fall an, auch beim Ortswappen von Steinbach.
In diesen alten Zeiten gab es am Rande des Dörfchens Steinbach einen tiefen Brunnen, in dem eine hilfsreiche Brunnenfee ihren Wohnsitz hatte. Sie sorgte dafür, dass das Wasser klar und sauber war, dass die unterirdischen Quellen immer richtig sprudelten und nicht von einstürzendem Erdreich verstopft wurden. Der Brunnen wurde jedoch von den Dorfbewohnern wenig benutzt, da ein zweiter Brunnen in der Dorfmitte für die wasserholenden Hausfrauen bequemer zu erreichen war. Damals gab es ja noch keine Wasserleitungen, so dass meist die Frauen oder Mädchen mit zwei Eimern, die sie an einem Tragegestell über der Schulter trugen, das nötige Wasser ins Haus holen mussten.
Es gab aber auch einige Frauen in Steinbach, die den weiteren Weg zum Brunnen am Dorfrand nicht scheuten, weil dessen Wasser viel frischer war und ganz besonders gut schmeckte. Noch keine der wasserholenden Frauen hatte die Brunnenfee jemals zu Gesicht bekommen, und niemand wusste von ihrem verborgenen Dasein. Nur in seltenen Vollmondnächten kam sie zur Oberfläche, setzte sich auf den Brunnenrand und betrachtete ihr Spiegelbild im klaren Wasser.
Eine der Wasserholerinnen, die täglich zum Brunnen kam, war die Frau eines armen Kleinbauern, der im Wald tödlich verunglückt war und sie mit zwei Kindern allein zurückgelassen hatte. Sie wohnte nahe dem Dorfrand und scheute trotz ihrer vielen Arbeit den etwas weiteren Weg zum Brunnen nicht. Da sie die beiden noch kleinen Kinder zu versorgen hatte und viel Wasser brauchte, musste sie an manchen Tagen zweimal mit den schweren Eimern das notwendige Nass heimholen. Die Brunnenfee hatte die junge Frau oft beobachtet, wenn sie einige Minuten erschöpft am Brunnenrand ausruhte, und hätte ihr gern geholfen. Oft brachte die Frau auch ihre beiden Kinder mit, sorgte aber dafür, dass sie nicht etwa kleine Steine ins Wasser warfen. „Das tut dem Wasserspiegel weh“, sagte sie zu den Kindern, und außerdem werde das Wasser trübe.
Zu dieser Zeit bestand auf dem Stuhlberg, der sich am nördlichen Rand des nahen Dorfes Oberhöchstadt erhebt, ein Gerichtsplatz. Während schwere Verbrechen in den größeren Orten des Gebiets abgeurteilt wurden, kamen die kleineren Sünden, etwa Holzdiebstähle oder bescheidene Wildereien, auf dem Stuhlberg zur Verhandlung. Dabei waren die Strafen damals auch für geringe Vergehen hart, und mancher Holzdieb wurde empfindlich bestraft, in außergewöhnlich schweren Fällen sogar mit dem Verlust der rechten Hand.
Dabei war es oft schwierig, zu entscheiden, ob etwa ein armen Mann, der aus Hunger einen Hasen gewildert hatte, diesen auf Steinbacher Gelände oder gar auf benachbartem, strenger geschützten Gebiet erwischt hatte, was für die Strafe von großer Bedeutung war. Ebenso war es bei den Holzdiebstählen. Da es damals kein anderes Brennmaterial gab und die Winter oft sehr hart waren, reichte das aus dem Gemeindewald zugeteilte Holz in manchen Familien nicht aus, besonders wenn kleine Kinder im Haus waren und viel gewaschen werden musste. Da kam es leicht vor, dass der eine oder andere im Nachbarwald auf die Holzsuche ging oder gar irrtümlich sich an fremdem Holz vergriff, weil ihm die Grenzen nicht so genau bekannt waren. Aber danach fragten die strengen Richter auf dem Stuhlberg wenig. Ob absichtlich oder irrtümlich, Holzdiebstahl war Diebstahl und wurde, wenn man den Sünder erwischte, hart bestraft.
Auch die junge Frau, die täglich zum Wohnsitz der Brunnenfee kam, hatte Kummer mit dem Holz, das ihr im Gemeindewald zugeteilt wurde und das nie ausreichte. Da sie die Sauberkeit liebte und für die beiden Kinder viel zu waschen hatte, und da auch der letzte Winter sehr kalt gewesen war und große Löcher in den Holzvorrat gerissen hatte, ging sie öfter in den Gemeindewald, um wenigstens das Abfallholz zu sammeln.
So war sie eines Nachmittags mit den beiden Kindern wieder einmal in den Wald gewandert um Abfallholz und Zweige zu sammeln. Als sie, gefolgt von den Kindern, zwischen den Bäumen dahin ging, fand sie einige besonders schöne Pilze, die sie gern mitnehmen wollte. Es waren prächtige dunkelbraune Maronenröhrlinge, jung und fest, die eine gute Mahlzeit abgeben würden, wenn sich eine genügende Menge davon finden ließ. Nicht weit entfernt erspähte sie weitere dunkelbraune Pilzköpfe auf dem Waldboden. Die Frau folgte ihnen und geriet immer weiter in ein fremdes Gebiet hinein. Eifrig sammelte sie die schönen Pilze in ihr Kopftuch, und als sie einen dicken dürren Ast zwischen den Bäumen fand, nahm sie auch diesen mit, um ihn ihrem Holzbündel einzuverleiben. Da stand plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, der Förster aus dem Nachbarbereich vor ihr und warf der erschrockenen Frau vor, sie habe Holz im verbotenen Revier gestohlen. So sehr die Frau auch beteuerte, sie habe beim Pilze sammeln nicht auf die Grenze geachtet, so half ihr das wenig, und auch ihre Tränen rührten den Förster nicht. Er vermerkte ihren Namen und erklärte, sie werde beim nächsten Gerichtstag auf dem Stuhlberg sich wegen Holzdiebstahls zu verantworten haben.
Die Schuld, die sie unabsichtlich auf sich geladen hatte, lastete in den nächsten Tagen schwer auf ihr, denn in Kürze sollte das Gericht auf dem Stuhlberg zusammentreten, und was sollte dann werden, wenn sie mit dem Entzug der Holzzuteilung oder noch schwerer bestraft würde?
Traurig wanderte sie eines Morgens mit ihren Eimern zum Brunnen, wo sie am Brunnenrand ermattet niedersank. Die Brunnenfee, der nichts von ihrem Erlebnis verborgen geblieben war, empfand tiefes Mitleid mit der geplagten Frau und überlegte, wie sie ihr helfen könne. Sie tauchte zum Grunde des Brunnens, wo sie unter einem großen Stein ihren Schmuck aufbewahrte, entnahm ihm eine schwere goldene Kette, und als die Frau ihren Eimer herabließ um das Wasser zu schöpfen, ließ sie die Kette in den Eimer gleiten.
Als die Frau den Eimer hochgezogen hatte und die Sonne in das klare Wasser fiel, blinkte und funkelte es am Boden des Eimers so auffallend, dass die Frau näher hinsah und die kostbare Kette entdeckte, die sie staunend heraushob und betrachtete. O Gott, dachte sie erschrocken, wie kommt dieses Kleinod in den Brunnen? Wem mag es wohl gehören und kann ich es wohl behalten? Als sie noch, halb erfreut aber auch halb furchtsam, über den Fund nachdachte, hörte sie plötzlich aus der Tiefe des Brunnens die zarte Stimme der Brunnenfee, die ihr freundlich zurief: „Nimm nur die Kette, sie gehört dir. Wenn du sie zu Geld machst, kannst du deine Strafe bezahlen und dir Holz kaufen, soviel du brauchst“.
Erstaunt sah sich die Frau um, aber nirgendwo war eine Menschenseele zu erblicken, und in dem Brunnen, von wo die Stimme herkam, war nur der klare Wasserspiegel zu erkennen.
Hocherfreut und glücklich über den rechtmäßigen Besitz der Kette eilte die Frau nach Hause und verbarg den Schatz sorgfältig. Da sie um diese Jahreszeit fast allwöchentlich mit zwei Körben voller Pilze in die nahe Reichsstadt zu wandern pflegte, wo die Pilze gut bezahlt wurden, nahm sie die Kette auf ihrem nächsten Stadtgang mit und legte sie einem Goldschmied vor mit der Frage, ob die Kette wertvoll wäre. Sie sei ein altes Erbstück und sie wolle sich von ihr trennen, da sie in großer Not sei. Der Goldschmied, der ein ehrlicher Mann war, staunte über das kostbare Stück. Nachdem er die Kette gewogen und genau untersucht hatte, bot er ihr fünf Goldstücke und meinte, sie sei wohl noch wertvoller, aber da sie schwer verkäuflich sei, könne er ihr nicht mehr dafür geben. Die Frau, die kaum mit einem einzigen Goldstück gerechnet hatte, nahm das Angebot hocherfreut an.
Für eins der Goldstücke kaufte sie Kleidung für die Kinder sowie Lebensmittel ein und es blieb ihr noch ein stattliches Wechselgeld übrig. Voller Glück wanderte sie den weiten Weg nach Steinbach zurück und sah nun in gefasster Erwartung dem peinlichen Gerichtstag entgegen.
Wenige Tage später trat der Gerichtstag auf dem Stuhlberg zusammen. Die Frau wurde von einem Büttel vorgeführt, und als sie an die Reihe kam und mit tränenden Augen ihre Unschuld beteuerte, fand sie milde Richter. Zehn Tage Fronarbeit sollte sie im Walde als Buße verrichten, da sie wohl kein Geld habe, die Strafe abzulösen. Das können sie wohl, sagte jedoch die Frau zum Staunen des Gerichts. Sie habe von einer reichen Gönnerin ein Goldstück geschenkt bekommen, das sie gern opfern wolle, wenn ihr die Strafe erlassen würde. Zur Verwunderung der Richter zog sie eins der Goldstücke, das sie mitgenommen hatte, hervor und überreichte es den Richtern. Das sei mehr als genug, meinten diese und erließen ihr die Strafe.
Die Sache mit dem Goldstück hatte sich rasch in dem kleinen Dorf herumgesprochen, und die Leute zerrissen sich die Mäuler, woher das Goldstück wohl gekommen sei und wer es der Frau geschenkt haben könnte. Lange widerstand die junge Bäuerin den ewigen Fragen, aber als sie eines Tages die ständigen Sticheleien satt hatte, erzählte sie die Geschichte, die sie am Brunnen erlebt hatte.
Der Brunnen am Dorfrand fand plötzlich weit mehr Beachtung als bisher. Wo eine goldene Kette gelegen habe, meinte man, könne wohl noch mehr liegen. Die Frauen konnten daher ihre Eimer gar nicht tief genug hinunterlassen und glaubten fest, dass ihnen vielleicht einmal ein ähnliches Glück beschieden sei. doch keine von ihnen hat je einen Schatz aus dem Brunnen gehoben, und auch die Stimme der Brunnenfee haben sie nie gehört.
Aber den Brunnenquell hatten die Steinbacher in der Zwischenzeit kennen und schätzen gelernt. Sie waren stolz auf das klare und so gut schmeckende Wasser ihres Brunnens, zu dem bald Leute aus Nah und Fern kamen um es für besondere Zwecke zu holen. Als eines Tages der Gemeinderat zusammenkam, um über ein Ortswappen zu beraten, meinte einer der Gemeinderäte, das Einzige, was Steinbach von den Nachbargemeinden unterscheide, sei der Brunnen, der allgemein als der beste im ganzen Umkreis gelte. Ihn sollte man in das Wappen aufnehmen. So geschah es, und seit dieser Zeit führt Steinbach einen Brunnen als Wappenzeichen.
Die junge Bäuerin aber fand wieder einen braven Mann, der für sie und die Kinder sorgte. An jedem Pfingstmorgen ging sie in aller Frühe zum Brunnen und warf, dankbar für die ihr zuteilgewordene Hilfe, einen kleinen Blütenzweig hinein. Dann tauchte die zarte, weiße Hand der Brunnenfee auf, nahm den Zweig und die Frau hörte in der Tiefe ein leises, silbernes Lachen. Aber das blieb ein Geheimnis zwischen den beiden, und die uralte Steinbacherin konnte mir nur davon erzählen, weil die Frau ihre Ahnin gewesen war und der Pfingstbrauch des Gangs zum Brunnen sich in ihrer Familie erhalten hatte. „Heute“, so sagte sie dann, „geht niemand mehr zum Brunnen, aber ich weiß die Stelle noch und habe sie meiner Enkelin gezeigt, damit das Geheimnis nicht stirbt. Wenn sie das Ohr auf die Erde legt, so meint sie, man höre die Quellen drunten rauschen und zuweilen auch die Brunnenfee in der Tiefe singen.“
Quelle: „Der Ring im Urselbach“. Märchen und Geschichten aus dem Taunus von Georg Volker Dietrich. Erschienen 1978 im Altkönig-Verlag Oberursel.